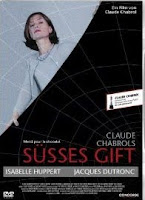Eigentlich wollte ich keinen Weihnachtsfilm besprechen. Denn, ach, was werden sie nicht jährlich durchgekaut, diese Warnungen vor dem Licht im Dunkeln, das lediglich unsere Brieftaschen leert und zu Streitereien führt, weil wir eine derartige Ansammlung von Feiertagen gar nicht ertragen - von "A Christmas Carol" (1938) über "The Bishop's Wife" (1947) bis hin zu "The Nightmare Before Christmas" (1993) und "Love Actually" (2003)! - Doch dann erschien mir nächtens (vielleicht war ich auch nur besoffen) ein Engel und sprach also zu mir: "Gebenedeit bist du unter den Bloggern, Whoknows! Siehe: Der Herr hat dich auserkoren, über einen Weihnachtsfilm zu schreiben, der üblicherweise gar nicht als solcher wahrgenommen wird. Und nun hurtig: Klemm dich in den A***h, bevor ihn dir mono.micha (woher kennen die himmlischen Heerscharen den alten Schlawiner bloss?) für seinen Schweizer-Film-Marathon vor der Nase wegschnappt!" - Na schön, dachte ich, ist immer noch besser als eine Jungfrauengeburt...
Gilberte de Courgenay
(Gilberte de Courgenay, Schweiz 1941)
Regie: Franz Schnyder
Darsteller: Anne-Marie Blanc, Erwin Kohlund, Heinrich Gretler, Ditta Oesch, Rudolf Bernhard, Jakob Sulzer, Hélène Dalmet, Zarli Carigiet, Max Knapp, Schaggi Streuli u.a.
Wer je mit der Bahn von Delémont aus Richtung Porrentruy in die Ajoie, jene seltsame nördliche Ausbuchtung der Schweiz gegen Frankreich hin, gefahren ist, darf sich rühmen, das grenznahe Dörfchen Courgenay kennen gelernt, vielleicht sogar einen Blick auf das Hôtel de la Gare erheischt zu haben, das dank eines Films beinahe zur Legende wurde. In diesem “Hôtel” arbeitete zur Zeit des Ersten Weltkriegs die junge Gilberte Montavon und bewirtete Tausende Soldaten und Offiziere, die sie und ihr freundliches Wesen schwärmerisch verehrten. Der Bänkelsänger Hanns in der Gand komponierte sogar ein Lied, das der berühmten “Gilberte de Courgenay” gewidmet war.
Nach dem Abzug der Truppen im Sommer 1918 kehrte in Courgenay wieder Ruhe ein, und auch die berühmte Wirtstochter geriet langsam in Vergessenheit. Doch während des Zweiten Weltkriegs erfuhr sie als Vorbild für die “Geistige Landesverteidigung” eine unerwartete Renaissance und wurde zur Idealgestalt einer Soldatenfürsorgerin erhoben. Im Jahr 1939 erschienen ein Roman und ein darauf beruhendes Theaterstück, das in mehreren Schweizer Städten sehr erfolgreich aufgeführt wurde. - Der Stoff bot sich, dies erkannte Lazar Wechsler, Produzent der Praesens-Film gleich, förmlich für eine vom Nationalfonds geförderte Verfilmung an. Wechsler hatte jedoch den Unmut patriotischer Kreise auf sich gezogen, weil er die Regie für den ersten Schweizer Propaganda-Film, “Füsilier Wipf” (1938, mit Paul Hubschmid, der sich später je nach Angebot Hollywood oder den Nazis zur Verfügung stellte, ohne je ein bedeutender Schauspieler zu werden, in der Titelrolle), dem Ausländer Leopold Lindtberg übertrug. “Gilberte de Courgenay” gehörte, dies galt als Voraussetzung für eine Förderung, in die Hände eines Schweizers - und als Wunschkandidat bot sich der junge Theaterregisseur Franz Schnyder an, der später als Verfilmer von Gotthelf-Romanen in die Geschichte des Schweizer Films eingehen sollte - und von mir an anderer Stelle “gewürdigt” wurde. Erst kurz vor den Dreharbeiten 1941 liess sich General Guisan, der dem Projekt skeptisch gegenüberstand, dazu überreden, Truppen für die Soldatenszenen zur Verfügung zu stellen.
“Gilberte de Courgenay” erzählt eine gradlinige, selbstverständlich fiktive Geschichte: Im Winter 1915/16 quartiert sich eine Artilleriebatterie in Courgenay ein. Die Soldaten (darunter mehrere Schauspieler wie Zarli Carigiet oder Schaggi Streuli, die später zu nationalen Berühmtheiten aufstiegen) denken, der Krieg sei bis Weihnachten beendet und sie könnten rechtzeitig zu ihren Familien zurückkehren. Um ihre Enttäuschung zu lindern, organisiert die junge Gilberte, die ihnen schon kurz nach der Ankunft eine deftige Berner Platte - Sauerkraut, Würste, Speck, Kartoffeln - aufgetischt hatte, für sie ein Weihnachtsfest, das - schmacht! - jeder Hollywood-Schnulze Konkurrenz zu machen vermag - und steigt rasch zum Frauenideal der “Geistigen Landesverteidigung” überhaupt, dem besten Beispiel für die uneigennützige Einsatzbereitschaft der Frau im Dienste der Armee, auf. - Sie kümmert sich um die Sorgen der Männer, auch um die von Kanonier Hasler, den sie heimlich liebt - und auf den sie am Ende vorbildlich verzichtet.
Franz Schnyders Erstling, in dem die Vorgesetzten mit Ausnahme des Fouriers nette Kerle sind und ihre Soldaten die meiste Zeit im “Hôtel” herumsitzen lassen (eine Darstellung, die ich, der ich als Schweizer Wehrmann doch auch eine gewisse Zeit in der Ajoie verbrachte, so nicht unterschreiben kann), erhielt mässige Kritiken, wurde jedoch zum Publikumserfolg und gilt heute wohl als DER Klassiker unter den Filmen zur “Geistigen Landesverteidigung”. Dies verdankt er vor allem jener jungen Schauspielerin, die der Gilberte ein Gesicht verlieh und mit dieser Rolle sogleich den Höhepunkt ihrer (filmischen) Karriere erreichte: Anne-Marie Blanc (1919-2009) hatte zwar schon in einzelnen Filmen mitgespielt (etwa Lindtbergs Verfilmung von Gottfried Kellers Novelle “Die missbrauchten Liebesbriefe”, 1940), ihre Darstellung als ebenso charmante wie rührende Gilberte sollte sie jedoch bis an ihr Lebensende begleiten. Obwohl Anne-Marie Blanc auch vereinzelt Rollen in ausländischen Filmen annahm (sie spielte etwa Hedwig Pringsheim in “Die Manns - Ein Jahrhundertroman”, 2001), blieb sie dem Schweizer Film treu, schlug sogar einen Siebenjahresvertrag aus Hollywood aus. Dass sie sich stattdessen mit Rollen in vergessenswürdigen Machwerken wie “Palace Hotel” (1952) oder “Klassezämekunft” (1988) begnügte, dürfte nicht zuletzt daran gelegen haben, dass sie, die Autodidaktin, eine passionierte Bühnendarstellerin blieb und neben Therese Giehse und Maria Becker als dritte “Grande Dame” in die Geschichte des Zürcher Schauspielhauses einging, immer wieder in bedeutenden Uraufführungen mitspielen oder sich etwa in Peter Hacks Solostück “Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe” ausleben konnte. - Wenn man jedoch bedenkt, dass Billy Wilder in “One, Two, Three” (1961) aus der Schweizerin Liselotte Pulver eine durchaus beachtliche robuste Version der Monroe zu erschaffen vermochte, dann kommt man kaum umhin, in Anne-Marie Blancs stiller Eleganz etwas von Ingrid Bergman zu entdecken.
“Gilberte de Courgenay” wirkt gegenüber späteren Propaganda-Filmen für die Schweizer Armee wie dem primitiven “Achtung, fertig, Charlie!” (2003) noch immer liebenswert und mit Freude am Detail in Szene gesetzt, mag er auch etwas Staub angesetzt haben. Aber wer lässt sich von einer solch hübschen und fürsorglichen jungen Frau wie Gilberte schon nicht verzaubern? Und verdiente dieses holde Wesen nicht sein eigenes Lied, das der Zuschauer natürlich auch im Film geniessen darf?
Ein solches Lied - nicht zuletzt ein Dank für das schöne Weihnachtsfest - sollte doch auch einmal unter dem heimischen Weihnachtsbaum gesungen werden. Es könnte die Glöcklein zum Wimmern und die Engel zum Kreischen bringen. - In diesem Sinne wünsche ich meinen Lesern